Zugegebenermaßen bin ich manchmal nicht die Schnellste. Es hat vierundzwanzig Stunden gedauert, bis ich dahintergekommen bin, dass es sich bei der „Muffin-Sause“, nach der mich meine kleine Enkeltochter fragte, weil sie das Wort gelesen habe (ausgerechnet in einem unserer Bücher, das ihr in die Hände gefallen war) nicht um eine Veranstaltung für einen Haufen Kinder, die gern Muffins essen, handelt, so wie ich ihr das spontan erklärt habe. Sie merken, ich bin vielleicht nicht die Schnellste, aber ich kann durchaus spontan sein – nicht immer zu meinem Vorteil. In meinem Unterbewusstsein muss nächtens die Frage rumort haben, weshalb Ulrich und ich ausgerechnet eine solche Festivität in dem Buch behandelt haben. Mit dem Morgen dämmerte die Erkenntnis herauf, und seither habe ich Muffensausen, ob mit meinem Verstand auf meine alten Tage noch alles in Ordnung ist.
Es ist schon ein bisschen bedenklich: Ich habe vier Jahre gebraucht, um den Verschluss-Mechanismus einer geerbten Uhr zu kapieren und vierzig Jahre im immergleichen Wohnzimmer, um endlich den idealen Platz für den nachmittäglichen Tee zu finden.
Leider lässt sich das noch toppen: Auch mit der berühmt-berüchtigten Selbsterkenntnis ist es nach fast siebzig Jahren nicht besonders weit her. Mein Selbstbild und ich, wir starren uns manchmal fassungslos an und könnten uns fremder nicht sein. Mein Selbstbild ist das einer gelassenen, wohlüberlegten Frau, die mit dem nötigen inneren Abstand auf die Welt schaut und ich, ich bin so wütend, dass es schon peinlich ist, weil, es nützt ja nichts.
Da ist zum Beispiel die Sache mit den Menschen, die ihre Stellung und ihren Reichtum daraus beziehen, dass ihre Vorfahren andere gnadenlos ausgebeutet und bestohlen haben, dabei genauso gnadenlos über Leichen gingen und sich trotzdem „gnädige Landesväter“ nannten. Dass die Nachkommen dieses Fürstenpacks heute immer noch mit Ehrfurcht behandelt werden, dass man ihnen huldigt, sie hofiert, ihre dämlichen Titel mit wohligem Schauder in den Mund nimmt, sie immer noch „königliche“ oder „kaiserliche Hoheiten“ (Hohlheiten wäre wohl besser) nennt, ihnen gar erlaubt, ihre zusammengeklauten Besitztümer für ein immenses Geld an die zu verkaufen, denen die Schätze eigentlich gehören, den Bürgerinnen und Bürgern, uns, dem „Volk“ (in der damaligen Diktion von den Herrschenden oft „Lumpengesindel“ genannt), die Nachfahren derjenigen sind, die man genknechtet, wie Leibeigene behandelt, ausgeblutet hat, das ist ein solcher Skandal, dass mir die Galle hochkocht.
Entschuldigung, dieser Ausbruch ohnmächtiger Wut musste offenbar mal sein. Mein Selbstbild hat sich eh schon schamrot abgewandt. Zurückzuführen ist die Wut auf die Lektüre eines Buches, das ich trotzdem nur jedem ans Herz legen kann: „Die Flamme der Freiheit“, geschrieben von Jörg Bong und erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Bong schildert darin ausführlich all die Vorgänge während der nur 17 Monate währenden sogenannten „Revolution“ 1848/49. Es ist erhellend zu lesen, was damals alles von wem getan und was alles unterlassen wurde und es ist absolut zum Heulen, wenn man die Verschlagenheit, Verlogenheit und Menschenverachtung der Herrschenden von damals vor Augen geführt bekommt, die die, von deren Arbeit sie sich sattgefressen haben, erbarmungslos verhungern ließen.
Selbstverständlich können die Nachfahren von heute nichts für diese Schändlichkeiten – aber dass sie immer noch davon profitieren und sich was auf ihre Abkunft zugute halten, gar „stolz“ darauf sind, sich immer noch mit diesen Titeln „schmücken“, wenn man das so nennen kann, dafür können sie was! Welch eine Selbsterhöhung steckt hinter dieser Titelei! Und geht Selbsterhöhung nicht immer mit einer Erniedrigung der anderen einher? Der Titel sagt: „Wir sind nicht auf Augenhöhe, ich bin mehr als du, ich bin one up und du bist one down – und so soll es auch bleiben, denn mein ist das Reich, bis in alle Ewigkeit, Amen!“
Bei uns in der Gegend ist das im Moment präsent, weil gerade so ein Markgraf von Baden gestorben ist, weshalb man in der hiesigen Zeitung viel über die Familie dieses „Fürstenhauses“ las und mit „königlichen“ und „kaiserlichen Hoheiten“ nur so um sich warf und sich nicht entblödete zu schreiben, hätte es 1918 nicht die Republik gegeben, wäre er (über den ich nichts weiß und der mir als Persönlichkeit herzlich egal ist) „unser Landesvater“ gewesen. Nachdem ich gerade in Bongs Buch über die Machenschaften des damaligen „Landesvaters“ gelesen hatte, fand ich es reichlich dämlich, um nicht zu sagen erbärmlich, nicht stattdessen etwas über die finstere Seite dieser Landesherrlichkeit zu lesen.
Eieiei, da hat mich gerade ein schwerer Anfall republikanischen Furors überkommen. Als ich vor ein paar Jahren anfing, den Blog zu schreiben, habe ich angekündigt, dass ich von Dingen schreiben würde, die mich bewegen, und das haben Sie jetzt davon. Es überrascht mich selbst immer wieder, wo ich plötzlich lande. Aber um auf meinen Anfang zurückzukommen: Neulich, nach nur knapp über fünfundfünfzig Jahren Kenntnis der französischen Sprache, dämmerte mir, dass das Glück der Franzosen wohl auf das Erleben einer „guten Stunde“ zurückzuführen ist. Le bonheur in einer guten Stunde zu finden, vielleicht mit einem Tässchen Tee dabei, und gar nicht nach mehr zu verlangen, das ist ziemlich weise, finde ich und auch mein Selbstbild stimmt mir da zu. Und falls Sie nach der „Flamme der Freiheit“, was ich Ihnen hiermit nochmals dringend empfehle, noch etwas zum Beruhigen der Nerven brauchen, da habe ich auch einen Tipp: „Der liebe Augustin“ von Horst Wolfram Geißler ist ein so charmantes, liebenswürdiges, auch weises Buch, wie man es sich nur wünschen kann und rückt außerdem den Bodensee in das allerbeste Licht. Damit sind ein paar gute Stunden garantiert!



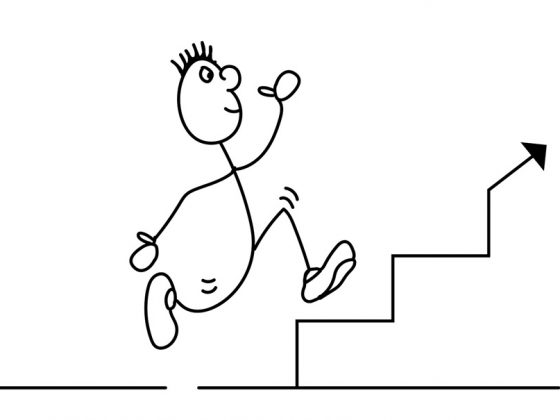
Das ist mal wieder Renate von der besten Seite….