In meinem Arbeitszimmer habe ich vor ewigen Zeiten eine Postkarte ins Regal gestellt, angelehnt an Bücherrücken, damit sie nicht irgendwo im Nirwana all meiner ausgerissenen Zeitungsartikel, Notizzettel, Briefe und was nicht alles verschwindet. Sie sollte mir mit ihrer Botschaft immer wieder ins Auge fallen, das ist auch nötig. Auf der Postkarte steht „Gib niemals auf!“ Ja, ich habe das nötig, tut mir leid, es zuzugeben. Allerdings steht die Karte da schon so lange, dass ich sie nicht mehr täglich bewusst wahrnehme.
Da ich ein begeisterter Zeitungsleser bin – Frühstück ohne Zeitung ist im Alltag wie Brot ohne Butter für mich und würde an Zumutung nur noch davon übertroffen, wenn Tee alle wäre – bin ich seit geraumer Zeit jeden Morgen erst mal ziemlich niedergeschlagen, also seit dem 24. Februar, um genau zu sein. Ich brauche dann immer ein bisschen, bevor ich mich innerlich wieder aufrichte. Ich könnte mir vorstellen, das kennen etliche von Ihnen. Die Klima-Katastrophe, das Wiedererstarken der Rechten überall, die Leistungen des Fussball-Nationalteams, die Texte deutscher Schlager sind schon schlimm genug, es hätte eigentlich gereicht. Und dann noch Monsieur Putain! Merde!
Es hilft auch nicht wirklich, ein im übrigen sehr gutes Buch mit dem Titel „Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein“ zu lesen. Der Autor Armin Falk, ein Verhaltensökonom, gibt Antworten auf diese Frage. Er und andere seines Fachs haben zahlreiche Experimente dazu durchgeführt und die Lektüre ist zugegebenermaßen manchmal ein bisschen ermüdend, es ist ein „Krimi“ der ganz speziellen Art, aber ich empfehle das Buch trotzdem absolut uneingeschränkt – jeder Schritt zur Reduzierung der Dummheit ist ein guter Schritt! Mir ist schon das eine oder andere Licht aufgegangen (Sagen Sie jetzt nicht, dazu gehöre vielleicht nicht allzuviel – und außerdem, jeder kleine Beitrag zählt, wie die Heilsarmee immer sagt). Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung, nichts ist nötiger. Also, ein wichtiges Buch, finde ich.
Um nun auf die Karte zurückzukommen: Mein Blick fiel mal wieder darauf und ich habe mir daraufhin wirklich einen Ruck gegeben: Gib niemals auf! Und dann habe ich mich an einen Mann erinnert, über den ich in einem anderen Zusammenhang für den newsletter der dehner academy schon mal geschrieben habe, über den ich hier aber nochmal berichten will. Ich bitte alle um Verzeihung, für die das jetzt ein alter Hut ist.
Niemals aufzugeben, diese Maxime bestimmte das Verhalten, das der bei uns ziemlich in Vergessenheit geratene Polarforscher Robert Shackleton seiner Mannschaft gegenüber an den Tag legte. Robert Shackleton und seine Mannschaft gerieten während seiner Endurance-Expedition in die Antarktis zwischen 1914 und 1916 in eine schier ausweglose Situation, denn die „Endurance“ geriet manövrierunfähig ins Packeis. Der Schutz, den das Schiff bisher geboten hatte, war nach einem drei Tage währenden Kampf, der jeden einzelnen Mann bis zur totalen Erschöpfung gefordert hat, endgültig dahin, das Schiff zerbrach. Die Männer mussten, um das nackte Leben zu retten, bei Minus 27 Grad in Zelten auf dem Eis kampieren. Kaum eingeschlafen, erwachten sie jedoch schon wieder, weil ein gewaltiger Riss sie spüren liess, dass sie nicht auf einer sicheren Scholle, sondern auf einer äußerst instabilen riesigen Eisfläche ihr Lager aufgeschlagen hatten. Das heißt, Shackleton musste Männer, die schon alles gegeben hatten, dazu motivieren, noch mehr Anstrengungen auf sich zu nehmen, nicht zu verzweifeln, nicht aufzugeben, sondern ihm zu folgen, damit alle gemeinsam einen sicheren Standort erreichen konnten.
Ich zitiere aus dem Buch „Shackletons Führungskunst“ von Margot Morrell und Stephanie Capparell:
Nur eine einzige Tagesstrecke von seinem Ziel, der Vahsel Bay an der antarktischen Küste entfernt, blieb das Schiff „wie eine Mandel in einer Tafel Schokolade“ im Packeis des Weddellmeeres stecken. Die Männer waren über 1200 Meilen vom letzten Außenposten der Zivilisation entfernt auf einer Eisscholle gestrandet. Jedes Mal, wenn es schien, als könnte ihre Lage unmöglich noch schlimmer werden, geschah jedoch genau dies. Das Packeis trieb das Schiff zehn Monate lang gefährlich nach Norden. Dann wurde die „Endurance“ zermalmt, und die Männer waren gezwungen, auf dem Eis zu kampieren. Einen Monat später mussten sie entsetzt zusehen, wie ihr Schiff auf den Meeresgrund sank. Niemand in Europa und Amerika wusste, dass ihnen etwas zugestoßen war. Alles, was ihnen zur Verfügung stand, waren drei unsichere Rettungsboote, die sie aus dem Schiff geborgen hatten. Jeder Mann durfte nur wenige überlebensnotwendige Gegenstände mitnehmen; mehr erlaubte Shackleton nicht. Goldmünzen und eine Bibel wurden als erstes zurückgelassen; gerettet wurden persönliche Tagebücher und ein Banjo.
Wenn die grimmigen Unwetter ihren Höhepunkt erreichten, mussten die Männer extreme Temperaturen ertragen, bei denen sie das Wasser gefrieren hören konnten. Die beißende Kälte ließ ihre Kleider festfrieren und verursachte brennende Schmerzen an Händen und Füßen. Sie schliefen in Zelten, die so dünn waren, dass sie den Mondschein durch die Zeltplane sehen konnten. Sie verbrachten fast vier Monate in der eisigen Dunkelheit der langen Polarnacht. Als der arktische Sommer endlich wärmere Temperaturen und die Aussicht auf ein wenig Erleichterung brachte, erwachten die Männer jeden Morgen in kalten Wasserpfützen, da ihre Körperwärme den Eisboden ihrer Zelte schmelzen ließ. Sie ernährten sich größtenteils von Pinguin- und Robbenfleisch – zuweilen auch von Hundefleisch – ein Speiseplan, der sie schwach und zittrig machte.
Wenn Sie denken, dass das alles war, muss ich Sie enttäuschen. Unter unvorstellbaren Bedingungen mussten die dreiundzwanzig Männer seiner Crew im ewigen Eis durchhalten und es ist einzig und allein Shackletons genialem Führungsverhalten zu danken, dass keiner aus der Mannschaft aufgab und alle Männer gerettet werden konnten. Denn nach den vier Monaten auf dem Packeis, mussten sie sich auf ihren drei kleinen Rettungsbooten in einen Überlebenskampf stürzen, der sie bis an die Grenzen ihrer Lebens- und Leidensfähigkeit brachte. Auf der Suche nach Land mussten sie fast eine Woche lang gegen das Meer kämpfen, frierend, hungrig und so durstig, dass ihnen die Zunge im Mund anschwoll. Und als sie schließlich Land erreichten, gab es direkt von dort keine Rettung. Ich zitiere noch einmal:
Als sie endlich Elephant Island erreichten, mussten sie feststellen, dass es sich um ein stinkendes, von Pinguin-Guano bedecktes Stück Land handelte, über welches ständig wilde Stürme hinwegfegten. Ein Großteil der Mannschaft verbrachte die letzten Monate ihrer qualvollen Odyssee kauernd unter zwei umgekippten Rettungsbooten.
Schließlich segelte Shackleton mit fünf Männern 800 Meilen in einem Rettungsboot über die stürmische See, zu der bewohnten Insel Südgeorgien im Südatlantik. Wie durch ein Wunder erreichten die Männer ihr Ziel mit knapper Not, mussten dann jedoch noch eine nahezu unpassierbare eisbedeckte Bergkette überqueren, um in die Zivilisation, zu einer Walfangstation zu gelangen. … Shackleton machte sofort kehrt und leitete eine Rettungsaktion für die übrigen, auf Elephant Island gebliebenen Männer ein. Erstaunlicherweise haben ausnahmslos alle überlebt. Das war Shackleton zu verdanken.
Einer der wichtigsten Grundsätze Shackletons war die unbedingte Wertschätzung, die Shackleton jedem Mitglied seiner Crew vermittelte, vom Offizier bis zum einfachen Seemann, vom Wissenschaftler bis zum Koch! Obwohl er wahrhaftig genug Sorgen hatte, schenkte Shackleton jedem einzelnen Mann Aufmerksamkeit, gleichgültig, ob er ihm nun besondere Sympathie entgegenbrachte oder nicht. Er schaffte es, durch einzelne Gespräche, für die er sich immer Zeit nahm, zu jedem eine persönliche Bindung aufzubauen. Er gab jedem das Gefühl, anerkannt zu sein – und welch ein Motivationsschub Anerkennung ist, das wissen Sie wahrscheinlich selbst.
Wie Shackleton persönliche Bindungen aufbaute, schilderte einer seiner Expeditions-Teilnehmer später so, dass Shackleton mit jedem Einzelnen sehr vertrauliche Gespräche führte, bei denen er sich nach dem Wohlergehen desjenigen erkundigte, wie er sich fühlte, wie es ihm gefiele, welche Aufgaben ihm am meisten Spaß machten. Das führte dazu, dass es Shackleton gelang, eine sehr gute Beziehung zu einer Mannschaft sehr unterschiedlicher Männer aufzubauen.
Dass er seinen Männern immer klar und eindeutig seine Wertschätzung vermittelt hatte, und dass er jedem von ihnen das Gefühl gab, wichtig zu sein für das Erreichen ihres Ziels, trug in hohem Maß dazu bei, dass sie an ihn glaubten. Shackleton wusste, dass sie nur dann eine Chance hatten, alle gemeinsam zu überleben, wenn die Männer ihm vertrauten. Und Shackleton wusste auch genau, wie er sich das Vertrauen seiner Mannschaft erwerben konnte. Er sprach ganz offen mit ihnen, er beschönigte nichts, er gab keine schwammigen Statements ab, er verschwieg nichts. Weil er es schon von Beginn der Reise an so gehalten hatte, hatten die Männer gemerkt, dass er absolut ehrlich zu ihnen war, also glaubten sie ihm, als es mehr als schwierig wurde. Und sie glaubten an ihn, als er ihnen seinen Plan vorstellte, was er zur Rettung zu tun gedachte. Einer seiner Expeditionsteilnehmer erinnerte sich daran so: „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Sache irgendwie diskutiert oder in Frage gestellt wurde. Wir steckten in der Klemme, und der Boss war der Mann, der uns aus dieser schlimmen Lage befreien konnte. Dass dies uns geradezu selbstverständlich erschien, beweist, wie sehr wir seiner Führung vertrauten.“
Die Männer mussten täglich mit dem Allerschlimmsten rechnen und durften trotzdem nicht den Mut und die Kraft verlieren, weiterzukämpfen – bei Minus 27 Grad und ohne zu wissen, ob und woher Rettung kommen sollte. Dass sie das geschafft haben, lag wohl einzig und allein daran, wie Shackleton es verstand, mit seinen Leuten umzugehen, sie täglich aufs Neue zu motivieren. So kam es, dass es trotz all der Schwierigkeiten Tagebucheinträge gab wie z.B. jenen von Expeditionsteilnehmer Dr. Macklin, der am 8. Dezember 1915 schrieb: „Es sind beängstigende Zeiten für uns, aber jeder ist zuversichtlich und guten Mutes.“
Doch wie reagierte Shackleton, als er von der instabilen Eisscholle aus mitansehen musste, wie das schöne Schiff, das ihm so viel bedeutet hatte, von den Eismassen zermalmt wurde? Aus den Erinnerungen seines Crew-Mitglieds Macklin wissen wir es: „Er reagierte wie immer: Was geschehen war, war geschehen, es lag in der Vergangenheit, und er blickte in die Zukunft… Er sagte ohne Emotion, Melodramatik oder Aufregung einfach: ‚Schiff und Vorräte sind weg, also schauen wir jetzt, dass wir nach Hause kommen.‘“ Sein Ziel, als erfolgreicher Expeditionsleiter mit einer Vielzahl neuer Erkenntnisse in die Geschichte einzugehen, warf er in dem Moment über den Haufen, als ihm klar wurde, dass daraus nichts werden würde. Aber er fasste sofort ein neues Ziel ins Auge: Jeden Mann seiner Crew heil nach Hause zu bringen!
Shackleton gab niemals auf und das gelang ihm, weil er niemals Kraft, Energie und Zuversicht dadurch aufs Spiel setzte, dass er etwas nachhing, das definitiv verloren war. Es kam ihm nicht in den Sinn, Ereignisse zu bedauern, die er nicht ungeschehen machen konnte oder die außerhalb seines Einflussbereiches waren. Stattdessen sagte er: „Ein Mensch muss sich sofort ein neues Ziel stecken, wenn sich das alte als unerreichbar erweist.“
Ich finde Shackletons Beispiel äußerst inspirierend – und ich fühle mich auch ein bisschen beschämt, wenn ich immer wieder erkennen muss, wie schnell ich mich entmutigen und dazu hinreißen lasse, den Zustand der Welt als hoffnungslos zu empfinden. Aber ich habe ja immer noch meine Karte! Ich werde sie wieder öfter zur Kenntnis nehmen!



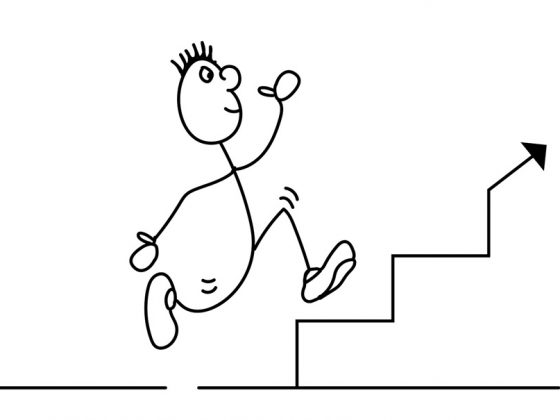
Danke für diesen inspirierenden Artikel, liebe Renate! Auf meiner Karte steht:
Wenn es ein Löwenzahn durch den Asphalt schafft, dann wirst auch Du einen Weg finden.
Na also…