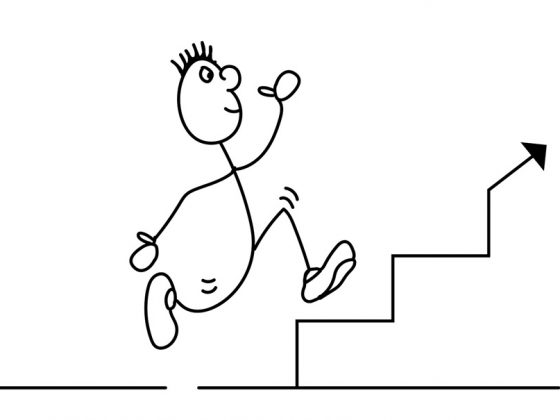Nun ist es also wieder Zeit, am Ende dieses Sommers, dem man wahrhaftig nicht den Vorwurf machen kann, er sei nicht groß gewesen – eher schon den, dass er reichlich über die Stränge geschlagen hat. Aber ich will mich gar nicht mit Hitze und Dürre aufhalten, alles, was dazu gesagt werden kann, wurde schon oft genug gesagt.
Lieber bleibe ich gleich bei Rilke – und um es auch gleich zuzugeben: Er ist die erste meiner Niederlagen. Dabei geht es mir nicht um seine Gedichte, sondern um seine Prosa. Er war ein wunderbar kluger Mann, der in seinen Briefen, Essays und Besprechungen anderer Künstler wunderbar kluge Sachen geschrieben hat. Er war aber auch von einer Hoffnung beseelt, die ich aus heutiger Sicht und mit dem Wissen, was das zwanzigste Jahrhundert, nur wenige Jahre, nachdem die nachfolgend zitierten Zeilen entstanden sind, der Welt gebracht hat, wahrhaftig nur rührend, anrührend, finden kann:
Vielleicht empfand er (das bezieht sich auf Maurice Maeterlinck, auf den ich später noch Bezug nehmen werde,R.D.) in diesem Augenblick deutlicher als je, dass auch wir immer an einer Zukunft arbeiten, die glücklicher sein wird und reifer als unsere Zeit. Glücklicher, weil die Seelen immer mehr durchdringen werden durch das Dunkel unseres Verstandes und unserer Leidenschaft, das uns voneinander trennt, und weil wir im Lichte der Seelen uns besser verständigen und besser helfen werden. Denn mit den Seelen steigt eine tiefe und große Gemeinsamkeit in uns auf, von der keiner ausgeschlossen ist, und die sich unserer bemächtigen muss, wie der Esprit de la ruche sich des Bienenkorbs bemächtigt hat, so dass es einmal möglich sein wird, von einem Esprit de la terre zu reden, der alle umfasst und vereinigt und die Kräfte ordnet, die sich jetzt noch widersprechen und aufheben.
Es ist zum Heulen, oder? Ich hoffe, Rilke war seiner Zeit entweder um mindestens zweihundert Jahre voraus – oder, das ist, was ich fürchte, er war ein hoffnungs- nein, nicht -loser, sondern viel zu hoffnungsvoller Träumer. Das Zitat stammt aus einem Essay mit dem Titel Maurice Maeterlinck, einem Schriftsteller, der zu meiner zweiten Niederlage wurde, aber bleiben wir noch bei Rilke.
Da ich von Rilkes Prosa in Briefen und Essays so angetan war, dachte ich, es sei nun an der Zeit, nach den Gedichten auch seinen einzigen Roman in Angriff zu nehmen Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Sorry, Rainer Maria, ich kann das nicht lesen! Diese Sätze, die ganz wunderbare Formulierungen und Geistesblitze enthalten, sie sind mir zu verschlungen, zu sehr dem Expressionismus, der damals schwer in Mode war, geschuldet und nach einiger Zeit fand ich das außerdem alles so trübselig, dass ich dachte, wenn ich depressiv werden will, reicht mir eigentlich die morgendliche Zeitungslektüre. So wurde der „Malte Laurids Brigge“ meine erste Niederlage.
Da ich über die Essays auf Maurice Maeterlinck gestoßen bin, von dem ich wohl irgendwie den Namen kannte, aber mehr auch nicht, will ich noch einmal Rilke zitieren, um zu erklären, wie es zu meinem zweiten niederschmetternden Versuch mit Literatur kam. Auch dieses Zitat findet sich im schon erwähnten Essay.
Aber wenn man die Geschichte so überschaut, mit ihren Kriegen und Abenteuern, ihren Entwicklungen und Zusammenbrüchen, ihren Sehnsuchten (sic), die sich bald nach deinen, bald nach der anderen Seite hin ausstrecken – so wird man nur ein unruhiges Flackern sehen und keine gemeinsame Idee herausfinden, welche diese Massen bald hierhin bald dorthin ruft. Man wird bestenfalls einige zeitliche Zwecke entdecken, die verschwinden, sobald sie sich erfüllen, und die Kette dieser Zwecke wird so verschlungen verlaufen, dass es nicht möglich sein wird, eine bestimmte Richtung darin zu erkennen, die die Lage eines endlichen Zweckes andeuten könnte. Diese Beobachtung hat indes den Philosophen Maeterlinck nicht entmutigt. Bei einem so komplizierten Gemeinwesen, wie es die Menschheit ist, kann das gemeinsame Ziel nicht gleich erkannt werden. Wir kennen es nicht und wir werden es vielleicht nie kennen. Es genügt, wenn jeder nur seine Rolle weiß und erfüllt; es genügt, wenn jeder dieses Ziel so hoch und erhaben annimmt, als er seiner Eigenart gemäß vermag, um eine gewisse Einheitlichkeit in den Seelen und ihren Bewegungen hervorzurufen – und die Hoffnung in uns zu erhalten, dass nichts, was wir tun, verloren gehen kann.
Diese Zeilen fand ich, vor allen Dingen den ersten Satz, so überraschend zeitgemäß, dass ich, nach Rilkes Hinweis, Maeterlinck habe sehnsüchtig an eine gemeinsame große Aufgabe des Menschengeschlechts geglaubt, den Entschluss fasste, etwas von diesem Mann, der 1911 immerhin den Nobelpreis für Literatur erhielt, zu lesen. Könnte ja tröstlich sein. Der Wikipedia-Hinweis, er sei „einer der wichtigsten Vertreter des Symbolismus“ gewesen, hätte mir zu denken geben sollen. Haben Sie schon einmal versucht, so etwas zu lesen? Ist es Ihnen geglückt? Hut ab!
Ich habe es mit „Der Schatz der Armen“ probiert. Nach gut der Hälfte musste ich meine Niederlage eingestehen – ich würde nie kapieren, was uns der Autor damit sagen wollte! Es geht um die Seele, schon klar, aber was Maeterlinck dazu gebracht hat, Dinge zu schreiben wie „Denn an dem Punkte, wo der Mensch zu enden scheint, fängt er wahrscheinlich erst an, und seine wesentlichsten und unerschöpflichsten Teile befinden sich nur im Unsichtbaren, wo er unaufhörlich auf der Hut sein muss. Auf diesen Höhen allein gibt es Gedanken, welche die Seele billigen kann, und Vorstellungen, die ihr ähneln und die so gebieterisch sind, wie sie selbst. Dort hat die Menschheit einen Augenblick geherrscht, und diese schwach erleuchteten Spitzen sind vielleicht die einzigen Lichter, welche die Erde im Geisterreiche ankündigen.“
Und das waren noch ein paar der verständlicheren Sätze. Es tut mir unendlich leid, aber das ist zu hoch für mich. Ich bin eine praktisch veranlagte Frau mit beschränkten geistigen Fähigkeiten – noch selten wurde mir das so klar – wie gesagt, niederschmetternd.
Kommen wir zur dritten Niederlage, ich mach es so kurz wie möglich. Rainer Maria Rilke wurde, weil er immerzu knapp bei Kasse war, großzügig von dem von mir heißgeliebten Harry Graf Kessler (lesen Sie seine Tagebücher!!! Und wenn Sie sie schon mal gelesen haben, lesen Sie sie wieder!) finanziell unterstützt, gemeinsam mit einer seiner Bekannten, der Grande Dame der Gesellschaft, Botschaftergattin, exzellenten Pianistin und außerdem ziemlich eifrigen Autorin Mechtilde Fürstin Lichnowsky. Deren Werke wurden nun jüngst wieder ausgegraben und in einer schönen Gesamtausgabe veröffentlicht, versehen mit einer enthusiastischen Würdigung von Eva Menasse. Sie beschreibt sie als „zweifellos eine Stilistin hohen Ranges…Die Frische und Originalität, mit der einen Lichnowskys Sprache … anspringt, ist lustig, lebendig, vitalisierend.“ Eva Menasse spricht Lichnowsky „präzise Anschaulichkeit, gepaart mit feinem Witz“ sowie einen „ebenso direkten wie kreativen sprachlichen Zugriff“ zu. Naja, und so weiter, ich will Sie nicht mit noch mehr Zitaten langweilen.
Wenn nicht allein die Tatsache, dass Lichnowsky eine Bekannte Kesslers war und sich in denselben Kreisen bewegte, mich für sie interessiert hätte, so hätte dieser Essay von Eva Menasse, der auch in der SZ erschienen war, mich veranlasst, die vier Bände zu kaufen. Sie erraten es schon, es war eine weitere Niederlage, die mir schmählich klarmachte, dass ich offenbar für die schöne Literatur und für stilistische Meisterinnen und Meister in derselben hoffnungslos ungeeignet und deshalb verloren bin. Oh mein Gott, ging mir diese Frau mit ihren merkwürdigen Gedankengängen und sonderbaren Formulierungen, von denen ich die Hälfte leider nicht ganz kapierte, auf die Nerven! Meine Vermutung ist, sie wollte so unbedingt, so schrecklich gern eine „Künstlerin“ sein, aber vielleicht war es damals einfach nur Mode, einen „expressiven“ Schreibstil zu pflegen. Aber was weiß ich schon! Als die Buchhändlerin meines Vertrauens, mit der ich über mein Dilemma, ob ich aufhören oder weiterlesen sollte, meinte, das Leben sei zu kurz, um es mit Büchern zu vergeuden, die einem auf die Nerven gehen, legte ich die zwei Bände, die ich noch vor mir gehabt hätte, erleichtert ad acta.
Und dann habe ich eines in die Hände bekommen, das mir wirklich großes Vergnügen bereitet hat! Ob es daran liegt, dass es keine „schöne Literatur“ sein will, sondern nur ziemlich amüsant Fakten schildert? Das sehr schön ausgestattete Buch trägt den Titel „Napoleon schläft mit Mona Lisa“, ist von Stefan Schlögl, der es geschrieben und Wolfgang Hartl, der es illustriert hat und macht, glaube ich, auch Leuten Spaß, die sich nicht so für Geschichte interessieren. Napoleon war nicht der Erfinder der fake news, aber ein unbestreitbarer Meister darin. Wie sehr, das zeigt das Buch sehr anschaulich. Es war für mich, das nur nebenbei, natürlich auch eine große Genugtuung festzustellen, dass ich jeden Satz verstehe, der da steht – als alte Schachtel hat man ja schon immer die Angst im Hinterkopf, dass Alzheimer zugeschlagen haben könnte, wenn man ratlos vor Sätzen steht. Es war mir jedenfalls möglich, auch die bedauerlichen Grammatikfehler, die sich gleich zu Beginn des ersten Kapitels finden, zu identifizieren. Die haben meine Wohlgeneigtheit aber nicht beeinträchtigt – das Buch ist ein Gewinn!